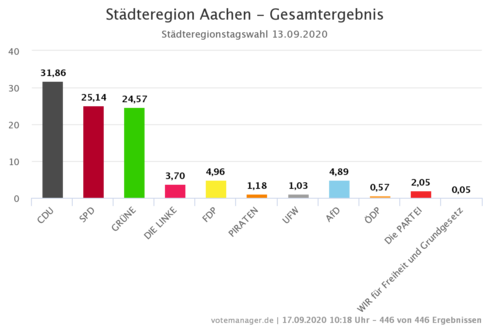Sibylle Keupen zur Oberbürgermeisterin von Aachen wählen
Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Aachen am 27.9.2020 – damit Aachen wieder nach vorne kommt, Sibylle Keupen zur Oberbürgermeisterin von Aachen wählen!

Klimaschutz Veranstaltung am 21.8.2020, 18 Uhr Marktplatz Brand
Die Brander Grünen laden ein zur Veranstaltung:
Klimaschutz, Energiewende und Regionale Wertschöpfung
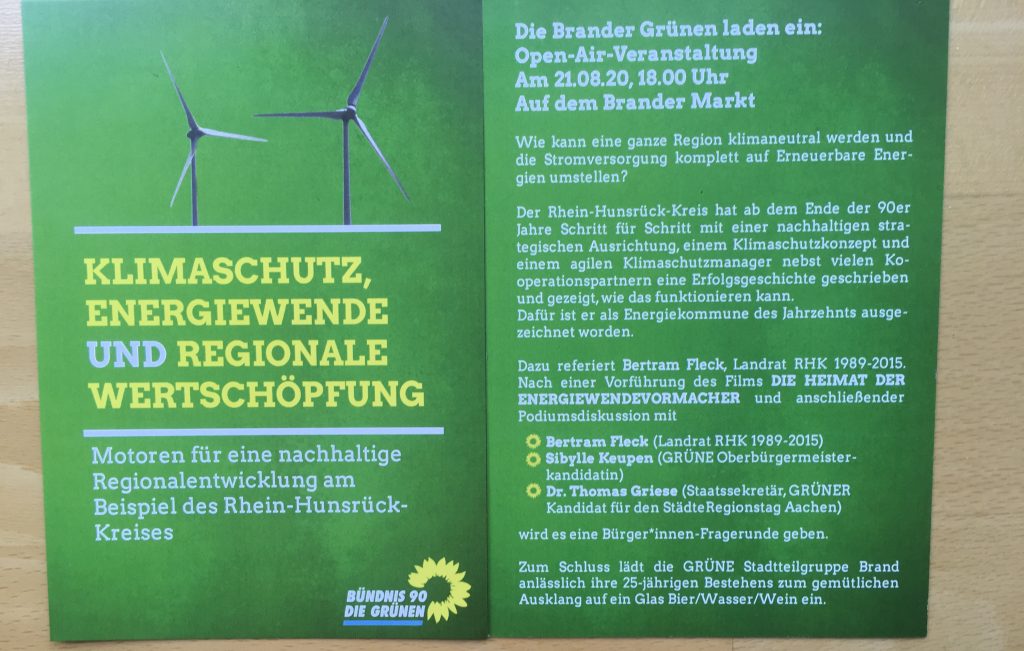
Kernfusion-eine ewige Fata Morgana
Manche Atomfreunde nehmen die jetzt begonnene Montage des Kernfusionsreaktors ITER in Frankreich zum Anlaß, wieder Illusionen zu schüren über Atomkraft als Beitrag zum Klimaschutz.
Dazu muss festgehalten werden: Entgegen mancher Meldung wird ITER nie (!) Strom produzieren und voraussichtlich 2042 zurückgebaut.
Ziel ist allein der Nachweis, ob Kernfusion überhaupt (!) mehr Energie liefern kann, als sie selber verbraucht. Frühestens im Jahr 2035 wird der Reaktor mit Deuterium-Tritium beladen und versucht, aus Kernfusion für wenige Sekunden(!) Wärme zu produzieren. Erst der Nachfolgeforschungsreaktor DEMO könnte erstmals Strom aus Kernfusion erzeugen und das deutlich nach 2050. Falls die riesigen technologischen Herausforderungen gemeistert werden können. Ob und wann eine kommerzielle Nutzung möglich sein wird, ist seriös nicht zu beziffern. Für den Kampf gegen die Klimakrise kommt die Kernfusion, falls sie überhaupt je funktionieren sollte, Jahrzehnte zu spät
Ein Luftschloss also – und ein sehr teures dazu!